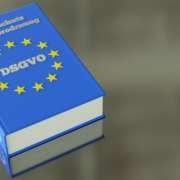Chancen für Compliance durch Nudging
Die Möglichkeiten des „Nudging“, Englisch für „anstupsen“, werden seit geraumer Zeit auf dem vergleichsweise neuen wissenschaftlichen Feld der Verhaltensökonomie diskutiert. Auch für das Thema Compliance könnte das „Anstupsen“ der Mitarbeiter im Sinne des rechtskonformen Verhaltens im Unternehmen große Bedeutung haben.
„Der Begriff „Nudging“ wurde durch den Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und den Rechtswissenschaftler Cass Sunstein geprägt („Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness“, 2008). Nudging möchte das Verhalten von Menschen positiv beeinflussen, ohne dabei auf Ge- oder Verbote zurückzugreifen. Der Mensch soll in seiner Entscheidungsfindung weiterhin frei bleiben, wird jedoch durch eine Veränderung der ihn umgebenden Umstände in die richtige Richtung „gestupst“. (Quelle)
Nudging fördert kluge rechtskonforme Entscheidungen
Nudging kann Mitarbeiter dazu veranlassen, kluge im Sinne rechtskonformer Entscheidungen zu treffen, ohne dass Zwang beispielsweise durch Androhung von Sanktionen ausgeübt wird. Die Verhaltensökonomie hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Menschen Entscheidungen – über den eigentlichen Inhalt hinaus – immer in einem gewissen Kontext treffen. Für die Umsetzung der Compliance bedeutet das, dass das gestaltbare Unternehmensumfeld mit dafür verantwortlich ist, ob sich die Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen regelkonform verhalten oder nicht.
Umsetzungsmöglichkeiten für Nudging
Wie kann das Umfeld nun so gestaltet werden, dass es regelkonforme Entscheidungen der Mitarbeiter positiv beeinflusst? Der Compliance Officer Dr. Jörg Viebranz zählt in seinem Artikel „Wie können Ideen der Verhaltensökonomie für Compliance und Integrity genutzt werden?“ (Quelle) interessante Beispiele auf:
- „Seien Sie sich der Macht der richtigen Formulierung bewusst. Beispielsweise können die Formulierungen von Verhaltenskodizes (Code of Conduct), spezielle Richtlinien und andere Informationsmaterialen erheblichen Einfluss auf die Regelbefolgung haben. Verhaltensökonomische Experimente haben gezeigt, dass die Aufforderung „Sei kein Betrüger“ im Gegensatz zu „betrüge nicht“ vor einem Test dazu führt, dass Teilnehmer weniger schummeln. Appellieren Sie in Formulierungen also an den Anstand der Personen und an ihr integres Selbstbild.
- Nutzen Sie Vorbildverhalten. Menschen orientieren sich an bekannten Verhaltensmustern und wollen nicht jede Entscheidung überdenken müssen. Verhaltensmuster werden häufig durch Beobachtung von Vorbildern gelernt und übernommen. Seien Sie sich bewusst, dass Vorgesetzte auch Vorbilder sind und sie durch ihr Verhalten die akzeptierten Verhaltensmuster von Mitarbeitern beeinflussen. Wie das am einfachsten umgesetzt werden kann?
-
- Machen Sie allen Führungspersonen im Unternehmen immer wieder klar, dass sie eine solche Vorbildrolle auch ausfüllen müssen.
- Setzen Sie den Punkt regelmäßig auf die Tagesordnung von Führungskräftemeetings.
- Vermeiden Sie Sonderregeln für unterschiedliche Hierarchiestufen, da dies von Mitarbeitern als Rechtfertigung für eigenes Fehlverhalten genutzt wird.
- Falls Abweichungen nicht vermieden werden können, erklären und kommunizieren Sie die Gründe hierfür intensiv.
- Der „Tone from the Top“ ist auf allen Hierarchiestufen wichtig. Nicht nur an der Spitze.
-
-
- Verinnerlichen Sie erwünschte Verhaltensmuster durch regelmäßige und praktische Schulungen. Belassen Sie es nicht bei einmaligen Präsentationen Ihres Verhaltenskodex. Wiederholen Sie Schulungen regelmäßig. Für so genannte Risikogruppen wie Vertrieb, Einkauf und Accounting sollten Sie 1-2 Mal pro Jahr eine Schulung einplanen. Machen Sie Schulungen so praktisch relevant wie möglich, indem Sie konkrete Fälle aus dem Alltag der Mitarbeiter diskutieren. […]
- Gestalten Sie kritische Entscheidungssituationen in Hinblick auf Compliance und rufen Sie die erwünschten Verhaltensmuster ins Gedächtnis. Bei einem Experiment wurde gezeigt, dass Probanden, die gebeten wurden, die Zehn Gebote aufzuschreiben, in einem nachfolgenden Test nicht schummeln. Genauso schummeln Studenten nicht, wenn ihnen vor dem Test mitgeteilt wird, dass dieser dem Ehrenkodex der Universität unterliege (selbst wenn die Universität über keinen solchen Kodex verfügt). […]
- Verstehen Sie sich als Dienstleister und machen Sie Mitarbeitern ihre Entscheidung so einfach wie möglich. Wenn Sie beispielsweise erwarten, dass Mitarbeiter erhaltene Geschenke bei Ihnen jährlich melden, dann unterstützen Sie diese durch ein elektronisches Zuwendungsregister oder stellen Sie ein einfaches Formular zur Verfügung, das nur die relevanten Daten abfragt und häufige Fälle als Multiple-Choice-Antworten zum Ankreuzen bereits vorformuliert.“
-
Nudging und Compliance bei SAT
Die Berater und Unternehmer bei SAT identifizieren Kostentreiber und Verschwendung in den Unternehmensstrukturen und -abläufen, um sie effizient und maximal wertschöpfend zu optimieren und zu modellieren. Unser Blick geht aber über die rein organisatorischen und monetären Aspekte hinaus. Als Praktiker aktivieren und motivieren wir Ihre Mitarbeiter zielorientiert auf allen Hierarchieebenen. Für SAT ist „Nudging“ vor allem der respektvolle und an die eigene Verantwortung appellierende Umgang mit Menschen in allen Bereichen eines Unternehmens – im Sinne zielführender Compliance.