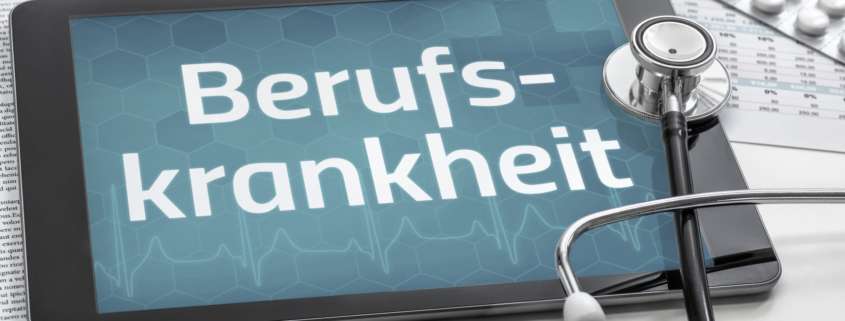Ärzte müssen Verdacht auf eine Berufskrankheit melden – was Unternehmen wissen müssen
Ärzte und Ärztinnen sind gesetzlich verpflichtet, den Verdacht auf eine Berufskrankheit oder eine arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr umgehend an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden. Darauf hat jüngst die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung noch einmal eindringlich hingewiesen. Diese Meldepflicht ist entscheidend, um Betroffenen schnellstmöglich zu helfen, die Prävention zu verbessern und die Anerkennung von Berufskrankheiten zu gewährleisten.
Warum ist die Meldepflicht so wichtig?
Die frühzeitige Meldung eines Verdachts auf eine Berufskrankheit hat mehrere entscheidende Vorteile:
- Schnelle Hilfe für Betroffene: Durch die Meldung können die Unfallversicherungsträger frühzeitig rehabilitative Maßnahmen einleiten, Therapien finanzieren und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am sozialen Leben erbringen. Je früher eine Berufskrankheit erkannt wird, desto besser sind oft die Heilungschancen oder die Möglichkeiten, eine Verschlimmerung zu verhindern.
- Prävention am Arbeitsplatz: Jede Meldung liefert wertvolle Daten. Die Unfallversicherungsträger können diese Informationen nutzen, um Schwerpunkte von Gesundheitsgefahren in bestimmten Branchen oder bei bestimmten Tätigkeiten zu identifizieren. Basierend darauf, werden Präventionsmaßnahmen entwickelt und Betriebe beraten, um zukünftige Berufskrankheiten zu verhindern.
- Rechtliche Absicherung: Die Meldung ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt werden kann. Nur wenn der Verdacht gemeldet wurde, kann der Fall bearbeitet und gegebenenfalls Entschädigung oder Rentenleistungen gewährt werden.
- Gesetzliche Verpflichtung: Die Meldepflicht ist in § 202 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) klar geregelt. Verstöße können rechtliche Konsequenzen haben.
Was fällt unter die Meldepflicht?
Ärzte und Ärztinnen müssen nicht nur eindeutige Fälle von Berufskrankheiten melden, sondern bereits den Verdacht darauf. Das bedeutet: Wenn aufgrund der Anamnese, der klinischen Befunde und der beruflichen Tätigkeit des Patienten der begründete Verdacht besteht, dass eine Erkrankung berufsbedingt sein könnte, ist eine Meldung notwendig. Dies gilt auch für Erkrankungen, die (noch) nicht in der Berufskrankheiten-Verordnung gelistet sind, aber durch die Arbeit verursacht wurden (so genannte “Wie-Berufskrankheiten”).
Typische Beispiele für Berufskrankheiten sind:
- Hauterkrankungen durch chemische Stoffe
- Lärmschwerhörigkeit
- Erkrankungen der Atemwege durch Stäube oder Dämpfe
- Muskel-Skelett-Erkrankungen durch repetitive Tätigkeiten oder schwere körperliche Arbeit
- Krebserkrankungen durch bestimmte Arbeitsstoffe
Wie erfolgt die Meldung?
Die Meldung des Verdachts einer Berufskrankheit erfolgt in der Regel formlos oder über spezieller Meldebögen des zuständigen Unfallversicherungsträgers. Ärzte und Ärztinnen sollten dabei so detailliert wie möglich die Art der Erkrankung, die Symptome, die berufliche Tätigkeit des Patienten und die möglichen Auslöser beschreiben.
Wichtiger Hinweis: Die Meldung muss auch das gemacht werden, wenn der Patient selbst keine Berufskrankheit vermutet oder keine Leistung beantragen möchte. Die Verantwortung liegt beim Arzt/bei der Ärztin.
Prüf- und Meldepflichten auch für Unternehmen
Auch Unternehmen selbst haben eine Meldepflicht, sobald sie Kenntnis von Anhaltspunkten für eine Berufskrankheit bei einem Beschäftigten erhalten. Die ärztliche Meldung löst hier oft einen Prozess aus, bei dem die Unternehmen ihre eigenen Informationen und Dokumentationen zur Verfügung stellen müssen.
- Drei-Tages-Frist: Sobald ein Unternehmen von einem Verdacht auf eine Berufskrankheit erfährt, muss es dies innerhalb von drei Tagen dem zuständigen Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse) melden. Dies kann oft durch die ärztliche Meldung angestoßen werden.
- Detaillierte Angaben: Unternehmen müssen umfassende Angaben zur Tätigkeit des Betroffenen, den möglichen Einwirkungen am Arbeitsplatz und den relevanten Arbeitsbedingungen machen. Dies erfordert eine sorgfältige Dokumentation von Arbeitsabläufen, Gefahrstoffen, Schutzmaßnahmen und Mitarbeiterschulungen.
- Einbindung des Betriebsrats: Sofern vorhanden, muss der Betriebsrat die Anzeige einer Berufskrankheit mit unterzeichnen oder über die Online-Anzeige informiert werden.
Prüfung durch den Unfallversicherungsträger
Nach der Meldung leitet der Unfallversicherungsträger ein umfangreiches Prüfverfahren ein. Dies kann für Unternehmen verschiedene Konsequenzen haben:
- Betriebsbegehungen und Ermittlungen: Der Unfallversicherungsträger kann Gutachten einholen, den Arbeitsplatz besichtigen und Ermittlungen zu den Arbeitsbedingungen im Unternehmen durchführen.
- Analyse von Gefährdungsbeurteilungen: Die Qualität und Aktualität der Gefährdungsbeurteilungen des Unternehmens wird genau geprüft. Lücken oder Mängel können hier schnell aufgedeckt werden.
- Mögliche Präventionsmaßnahmen: Stellt der Unfallversicherungsträger eine berufsbedingte Ursache fest, kann er dem Unternehmen konkrete Präventionsmaßnahmen vorschreiben, um ähnliche Erkrankungen in Zukunft zu vermeiden. Dies kann von der Bereitstellung neuer Schutzausrüstung über technische Umrüstungen bis hin zur Änderung von Arbeitsabläufen reichen.
Rechtliche und organisatorische Konsequenzen
Die Meldepflicht und das nachfolgende Verfahren können auch rechtliche und organisatorische Auswirkungen haben:
- Haftungsfragen: Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Arbeitgebers können trotz des Haftungsprivilegs der Unfallversicherung zivilrechtliche Ansprüche gegen das Unternehmen geltend gemacht werden.
- Pflicht zur nachgehenden Vorsorge: Bei bestimmten Gefährdungen (z.B. Asbest) besteht für Unternehmen auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Pflicht zur nachgehenden arbeitsmedizinischen Vorsorge für ehemalige Mitarbeiter. Die DGUV hat hierfür ein zentrales Meldeportal eingerichtet.
- Dokumentationspflichten: Die Bedeutung einer lückenlosen und präzisen Dokumentation aller arbeitsschutzrelevanten Daten, von der Gefährdungsbeurteilung bis zur Unterweisung, wird noch deutlicher.
Die ärztliche Meldepflicht für Berufskrankheiten ist ein wichtiges Signal an Unternehmen, ihren Arbeitsschutz ernst zu nehmen. Sie zwingt Unternehmen dazu, ihre Arbeitsbedingungen kritisch zu hinterfragen, potenzielle Gesundheitsrisiken zu identifizieren und geeignete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Ein proaktiver und umfassender Arbeitsschutz ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und letztlich in den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Je besser ein Unternehmen aufgestellt ist, desto geringer sind die negativen Auswirkungen einer gemeldeten Berufskrankheit.